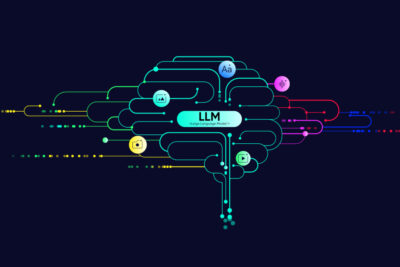„Künstliche Intelligenz“ begegnet uns täglich – zu Hause, im Büro, in der großen weiten digitalen Welt. Sie versteckt sich in Apps und in Softwareprodukten, quasi überall. Seit Februar 2025 haben Unternehmen daher laut der KI-Verordnung (KI-VO, englisch: AI Act) ihre Mitarbeitenden zu schulen. „KI-Kompetenz“ heißt das Zauberwort. Das bedeutet, über den Einsatz des KI-Systems zu informieren, entsprechende Vorgaben zur Parametrierung, Zweck und Nutzung zu geben.
Im Vordergrund stehen hier Fragen wie „Wofür darf die KI genutzt werden?“, „Wie ist das System einzusetzen?“ und „Welche Daten dürfen in den Prompt eingegeben werden?“. Namen, Adressen, Geburtsdaten, Geschäftszahlen, personenbezogene Informationen gehören bspw. nicht in ein KI-System, außer es ist auf einem eigenen Server gehostet und das IT-Team hat eine Mauer drum herum gebaut, sodass keine Daten an Dritte, z.B. in die USA, abfließen.
Von Halluzinationen bis Haftung – Risiken verstehen
Gleichzeitig sollten die Nutzerinnen und Nutzer die Risiken kennen, die mit KI einhergehen. KI-Systeme können beispielsweise halluzinieren und falsche Ergebnisse liefern. Deshalb ist es entscheidend, den ausgegebenen Inhalt stets kritisch zu prüfen. Hinzu kommt das Thema „Haftung“: Wird ein KI-System etwa in Auswahlprozesse bei Bewerbungen eingebunden, kann es dazu führen, dass Menschen aufgrund bestimmter Merkmale aussortiert werden – und damit wären wir bei Diskriminierung. Sich danach herauszureden mit „Das war nicht ich, das war die KI“ funktioniert nicht.
Ebenso bedenken nur wenige, dass es problematisch sein kann, einen Geschäftsbrief einfach in ein KI-Tool zu kopieren, um schnell eine Zusammenfassung zu erhalten. Die meisten haben solche Risiken nicht auf dem Schirm – das Tool wirkt schließlich auf den ersten Blick so praktisch.