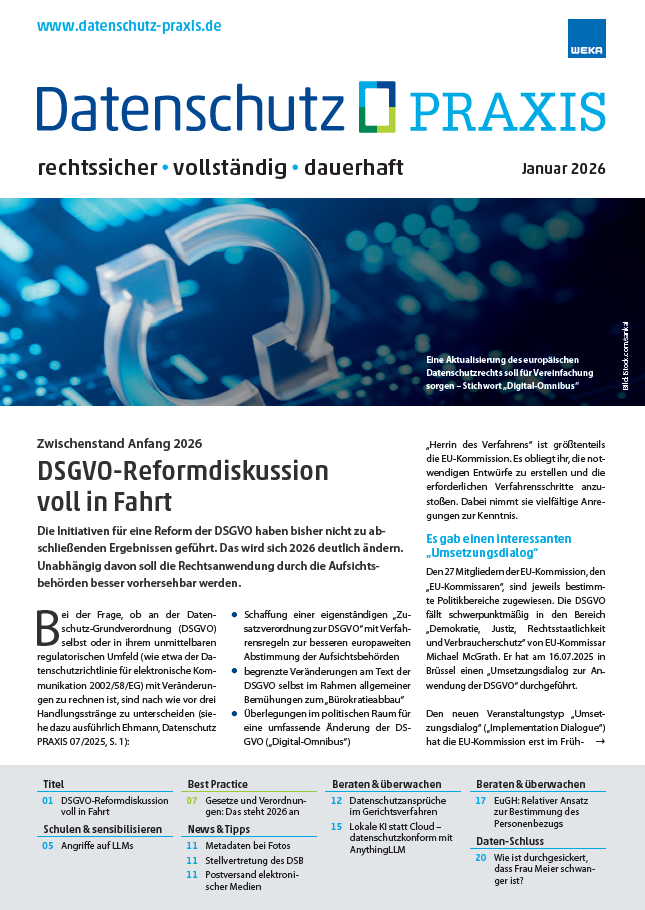Kein Schadensersatz für Übermittlungen in die USA

Konkret geht es um Datenübermittlungen im Zeitraum vom 16.7.2020 bis 11.7.2023. Diese beiden Eckdaten haben folgenden Hintergrund:
- Am 16.7.2020 erklärte der Europäische Gerichtshof (EuGH) das „Privacy Shield“ für ungültig.
- Am 11.7.2023 wiederum trat mit dem EU-U.S. Data Privacy Framework ein neues Datenschutzabkommen zwischen der EU und den USA in Kraft.
Damit gab es in der Zwischenzeit von fast drei Jahren kein Datenschutzabkommen zwischen der EU und den USA. Dennoch übermittelte die Betreiberin von Facebook weiterhin Daten des Klägers an ihre Konzernmutter in den USA. Der Kläger meint, dass ihm deshalb Schadensersatz gemäß Art. 82 DSGVO zusteht. Denn die Beklagte stützte sich bei ihren Datentransfers in die USA auf die jeweils geltenden Datenschutzabkommen zwischen der EU und den USA.
Standarddatenschutzklauseln (SCC) reichen aus
Nach Auffassung des Landgerichts München I war die Fortführung der Datenübermittlungen in die USA auch nach dem 16.7.2020 weiterhin rechtmäßig. Die Betreiberin von Facebook hatte mit dem Mutterkonzern in den USA – offensichtlich vorsichtshalber – Standarddatenschutzklauseln vereinbart. Sie bilden nach Auffassung des Gerichts eine ausreichende Rechtsgrundlage für Datenübermittlungen in die USA. Denn solche „Standard Contractual Clauses“ (SCC) lässt Art. 46 Abs. 2 Buchstabe c DSGVO als mögliche Rechtsgrundlage ausdrücklich zu.
Das Thema „TIA“ wird nur knapp gestreift
Nach Auffassung des Klägers hatte die Beklagte die bei der Verwendung von SCC zusätzlich nötige „Transfer-Folgenabschätzung“ gar nicht oder jedenfalls nicht in der nötigen Art und Weise durchgeführt. Dem trat die Betreiberin von Facebook jedoch entschieden entgegen. Sie versicherte, ein „Transfer Impact Assessment“ (TIA) sei durchaus erfolgt. Auf die offensichtliche Meinungsdifferenz geht das Gericht in seiner Begründung nicht weiter ein. Vermutlich ließen beide Prozessparteien diesen an sich wichtigen Aspekt letztlich dahinstehen.
Internationale Datenübermittlungen sind nötig
Datenübermittlungen können parallel auf mehrere Rechtsgrundlagen gestützt werden. Ein solcher Fall liegt nach Auffassung des Gerichts hier vor. Zwischen dem Kläger und der Beklagten besteht ein Vertrag über die Nutzung des sozialen Netzwerks Facebook. Zur Erfüllung dieses Vertrages ist es nach Meinung des Gerichts erforderlich, dass die Beklagte Daten an ihre Konzernmutter in die USA transferiert (Art. 49 Abs. 1 Buchstabe c DSGVO).
Schon die weltweite Suche nach Nutzern, die Facebook anbietet, setze einen grenzüberschreitenden Datenaustausch voraus. Dies sei jedem Nutzer, auch dem Kläger, hinlänglich bekannt. Es sei die freie unternehmerische Entscheidung der Beklagten sowie ihrer Konzernmutter, ob sie die dafür nötige Datenverarbeitung in den USA oder in einem anderen Land durchführen.
Der Kläger verstößt gegen Treu und Glauben
An sich hätte das Gericht die Schadensersatzforderung des Klägers schon mit der Begründung ablehnen können, dass die Verarbeitung seiner Daten durch die Beklagte rechtmäßig war. Denn ein Anspruch auf Schadensersatz nach Art. 82 DSGVO setzt einen Verstoß gegen die DSGVO voraus. Damit lässt es das Gericht jedoch nicht bewenden. Vielmehr hält sie dem Kläger zusätzlich noch folgendes vor:
- Seine Schadensersatzforderung verstößt gegen das Gebot von Treu und Glauben.
- Es ist allgemein bekannt, dass die Beklagte einen Dienst zur weltweiten Kommunikation anbietet und Tochter eines US-amerikanischen Unternehmens ist.
- Der Kläger hat diesen Dienst genutzt, obwohl ihm bewusst war, dass seine Daten auch in die USA übertragen werden.
- Dieses Verhalten ist widersprüchlich. Wenn sich der Kläger durch den Datentransfer in die USA tatsächlich schwer beeinträchtigt fühlte, hätte er die Nutzung des Dienstes beenden können. Dies hat er aber erst im Jahr 2024 getan, also nach dem hier relevanten Zeitraum.
- Insgesamt hat das Gericht den Eindruck, dass es dem Kläger nicht um den Ersatz tatsächlich erlittener Schäden geht. Die Datenübermittlungen die USA sei ein Vorgang, der ihn nur sehr eingeschränkt betreffe. Dennoch wolle er dafür Schadensersatz verlangen.
Manchen Gerichten scheint es zu reichen
Wie in Urteilen üblich, schildert das Gericht auch in diesem Fall, welche Argumente der Kläger vorträgt. Demnach hat der Kläger das Vorliegen eines Schadens unter anderem damit begründet, dass er wegen der illegalen Übermittlung seiner Daten in die USA unter körperlichen Beschwerden wie „Kälteschauer, Schwitzen und Schwindel“ leide. In diesem Zusammenhang vermerkt das Gericht sachlich-nüchtern folgendes: „Nach Auffassung des Gerichts dürfte es sich [bei der Argumentation] um einen nicht passenden Textbaustein aus einem Scraping-Verfahren handeln.“
Vor diesem Hintergrund überrascht es dann nicht mehr, dass das Gericht die geschilderten körperlichen Beschwerden als „zumindest sehr ungewöhnlich“ bezeichnet. Letztlich lässt es diesen Aspekt aber dahinstehen, weil ein Anspruch des Klägers auf Schadensersatz schon aus anderen Gründen scheitert. Dennoch liegt die Interpretation nahe, dass das Gericht die Darstellung des Klägers schlicht für nicht glaubwürdig hält.
„Scraping“ war ein anderes Thema
Bei den kurz angesprochenen „Scraping-Verfahren“ ging es um folgenden Vorfall:
- Im Jahr 2021 wurden Daten von rund 533 Millionen Facebook-Nutzern im Internet veröffentlicht. Unbekannte konnten die Daten abgreifen, weil es je nach Einstellung des Nutzerprofils möglich war, ein Profil über die Angabe der dazugehörigen Telefonnummer zu finden.
- Die Unbekannten haben automatisiert und in großem Umfang Telefonnummern über die Kontakt-Import-Funktion hochgeladen.
- Wenn eine Telefonnummer mit einem Profil verknüpft war, wurden die öffentlichen Informationen des Profils und die Telefonnummer zusammengeführt, abgegriffen und schließlich veröffentlicht.
Nach Auffassung des Bundesgerichtshofs stand den Betroffenen in diesem Fall wegen des Verlusts der Kontrolle über ihre Daten ein Anspruch auf Schadensersatz zu (siehe die Schilderung der Entscheidung bei https://www.datenschutz-praxis.de/pleiten-pech-pannen/kontrollverlust-als-schaden/).
Ob der Kläger selbst den vom Gericht beanstandeten Textbaustein entworfen hatte oder ob er von dem Rechtsanwalt stammt, der ihn vertreten hat, ist dem Urteil nicht zu entnehmen.
Das Urteil ist ein möglicher Vorbote für mehr
Im Augenblick handelt es sich bei dem vorliegenden Urteil um eine Einzelfallentscheidung. Falls jedoch vermehrt derartige Urteile ergehen sollten, würde dies das Thema „Datenübermittlungen in die USA“ möglicherweise entschärfen. Denn dass es widersprüchlich ist, einerseits einen Dienst zu nutzen, andererseits die bekanntermaßen damit verbundenen Datenübermittlungen beanstanden zu wollen, lässt sich in vielen Zusammenhängen als Argument verwenden.
Hier finden Sie das Urteil
Bei Eingabe des Aktenzeichens 33 O 635/25 ist das Endurteil des Landgerichts München I vom 27.8.2025 leicht im Internet zu finden, beispielsweise in der Rechtsdatenbank des Freistaats Bayern unter https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Y-300-Z-GRURRS-B-2025-N-25358?hl=true.