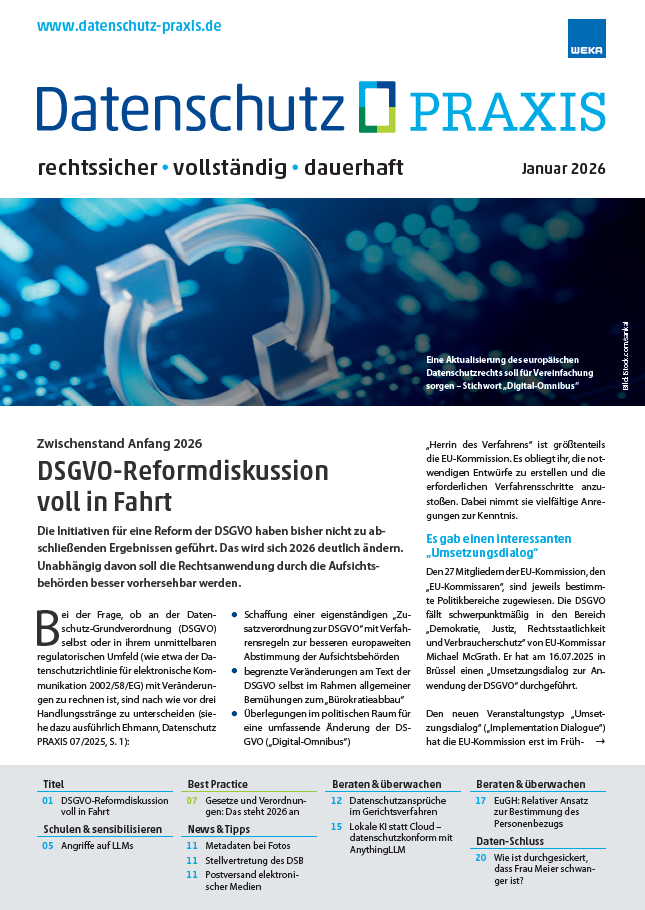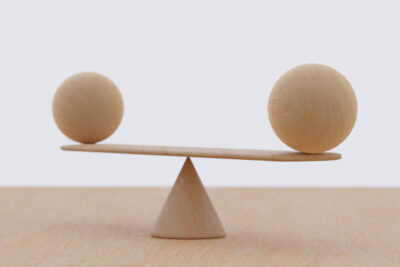Seit dem 25. Mai 2018 ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft, doch der Aufwand, den sie Unternehmen bereitet, bleibt unverändert hoch. Das belegen zahlreiche Umfragen. So gaben etwa in einer Bitkom-Studie aus dem Jahr 2023 rund 50 Prozent der Befragten an, dass der Aufwand für den Datenschutz seit Einführung der Verordnung gestiegen ist und voraussichtlich auch auf diesem Niveau bleiben wird. Weitere 33 Prozent erwarten sogar, dass der Aufwand in Zukunft noch zunehmen wird. Eine Umfrage der IHK Baden-Württemberg untermauert diese Ergebnisse: Über 80 Prozent der befragten Betriebe bewerten den durch die DSGVO verursachten Aufwand als „extrem hoch“. Dabei gilt im Datenschutz doch der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit.
Was versteht man unter Verhältnismäßigkeit?
Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit ist ein zentrales Prinzip im EU-Recht (EU-Vertrag Art. 5 (4)) und wird auch in Erwägungsgrund 170 der DSGVO aufgegriffen. Er sorgt dafür, dass Behörden und Organisationen ihre Befugnisse nicht einfach grenzenlos ausüben können. Stattdessen müssen sie immer ein ausgewogenes Verhältnis zwischen dem, was erreicht werden soll, und den Mitteln, die dafür eingesetzt werden, schaffen, so der Europäische Datenschutzbeauftragte.
Gerade wenn es um Grundrechte wie den Schutz personenbezogener Daten gehe, sei Verhältnismäßigkeit besonders wichtig. Jede Einschränkung eines Grundrechts müsse gerechtfertigt sein. Dabei gilt, „dass die Vorteile aufgrund der Beschränkung eines Rechts nicht durch die Nachteile der Ausübung des Rechts aufgewogen werden“.
In der Praxis bedeutet das, eine Balance zu finden: Einerseits müssen die Rechte und Interessen der betroffenen Personen geschützt werden, andererseits gibt es oft berechtigte Ziele, die eine Datenverarbeitung erforderlich machen. Verhältnismäßigkeit bedeutet hier, mit Augenmaß vorzugehen und die Auswirkungen auf alle betroffenen Personen so gering wie möglich zu halten.
Wichtige Aspekte der Verhältnismäßigkeit in der DSGVO
Das Prinzip der Verhältnismäßigkeit spiegelt sich in mehreren Grundsätzen der DSGVO wider:
1. Datenminimierung (Art. 5 Abs. 1 Buchst. c DSGVO)
Nach dem Prinzip der Datenminimierung dürfen bei der Verarbeitung immer nur so viele Daten erhoben werden, wie wirklich nötig sind, um den vorgesehenen Zweck zu erreichen. Alles, was nicht unbedingt erforderlich ist, hat in der Datensammlung nichts zu suchen. Der Grundgedanke dahinter: Weniger Daten, weniger Risiko.