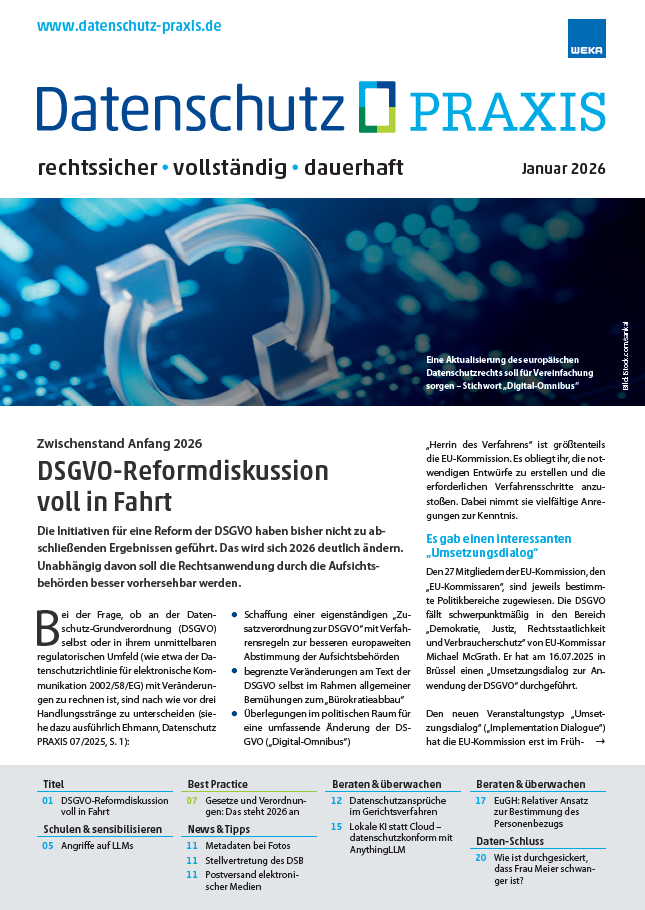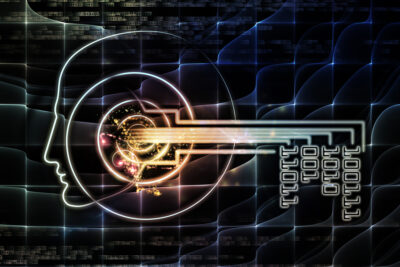Die Ortungs-App auf dem Handy der Tochter

Ein geschiedenes Paar lebt getrennt. Für die gemeinsame elfjährige Tochter liegt das alleinige Sorgerecht bei der Mutter. Gleichwohl hält sich das Kind etwa 30 % des Jahres bei seinem Vater auf. Dies ist in der Regel von Donnerstag bis Montag der Fall, auch wenn es Schultage betrifft. Bisher war das Kind nur eine ländliche Umgebung gewohnt. Ein Umzug führte es nach Wien. Dort tat es sich mit der Orientierung schwer und verirrte sich durchaus auch einmal in der Stadt.
Die besorgte Mutter installiert eine Ortungs-App
Mutter und Tochter beratschlagten, was weiterhelfen könnte. Die beiden wurden sich schnell einig: Die Mutter installierte die App „Pingo“. Sie ermöglichte es ihr, den Standort des Handys der Tochter zu ermitteln. Dies sollte weiterhelfen, wenn sich die Tochter einmal in der Stadt verirrt. Da das bereits vorgekommen war, ging es nicht nur um eine abstrakte Befürchtung.
Die Mutter ortet das Kind beim Vater
Am 10.5.2021 um 6:07 Uhr in der Früh führte die Mutter eine Standortbestimmung für das Handy ihrer Tochter durch. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Kind in der Obhut des Vaters. Deshalb war er zu diesem Zeitpunkt aufsichtspflichtige Person. Ob es noch weitere Standortbestimmungen gab, während sich das Kind bei seinem Vater aufhielt, ist nicht klar zu erkennen.
Daraus entsteht ein längerer Rechtsstreit
In jedem Fall lehnte der Vater derartige „Ortungsaktivitäten“ seiner Ex entschieden ab. Er wertete sie als unberechtigtes Eindringen in sein Privatleben. Unverzüglich stellte er seiner Tochter als Alternative ein anderes Handy ohne eine solche App zur Verfügung. Die Mutter wiederum wollte den Konflikt offensichtlich ebenfalls entschärfen. Auf dem alternativen Handy, das die Tochter von da an benutzte, hat die Mutter die App nicht installiert.
Der Vater war dennoch nicht bereit, die Angelegenheit auf sich beruhen zu lassen. Vielmehr reichte er am 19.5.2021 bei der zuständigen Datenschutzaufsicht, der österreichischen Datenschutzbehörde dsb, eine förmliche Datenschutzbeschwerde ein. Die Behandlung dieser Beschwerde zog sich hin. Am 4.1.2024 wies die Behörde die Beschwerde zurück. Ihr Kernargument: Die DSGVO ist hier überhaupt nicht anwendbar!
Auch durch diese Entscheidung kam die Sache nicht zum Abschluss. Denn der Vater legte gegen sie Beschwerde beim österreichischen Bundesverwaltungsgericht ein. Im Ergebnis brachte das dem Vater keinen Erfolg. Die Begründung, mit der das Gericht die Beschwerde zurückwies, ist von allgemeinem Interesse.
Streitpunkt ist die „Haushalts-Ausnahme“
Dreh- und Angelpunkt ist die Frage: Spielt es vorliegend eine Rolle, dass die DSGVO nicht anwendbar ist auf die Verarbeitung personenbezogener Daten durch natürliche Personen „zur Ausübung ausschließlich persönlicher oder familiärer Tätigkeiten“? Diese Ausnahme vom Anwendungsbereich der DSGVO legt Art.2 Abs.2 Buchstabe c fest.
Sie wird oft als „Haushalts-Ausnahme“ bezeichnet. Das ist bemerkenswert. Denn in der DSGVO selbst oder in den Erwägungsgründen zur DSGVO findet man den Begriff nicht. Gleichwohl hat er sich sogar international durchgesetzt. So gibt es als englische Entsprechung hierfür den Begriff „household exemption“. Etwas weniger verbreitet ist der äquivalente Begriff „Haushalts-Privileg“.
Die Mutter war der Auffassung, dass sie sich auf diese Ausnahme berufen kann. Schließlich sei es ihr bei der Installation der Ortungs- App nur darum gegangen, ihr Kind im Bedarfsfall finden zu können. Der Vater sah dies ganz anders. Schließlich habe die Mutter mithilfe der App die Möglichkeit, auch seinen Aufenthaltsort zu ermitteln, während sich das Kind bei ihm befindet.
Das Gericht hält die Ausnahme für anwendbar
Nach Auffassung des Gerichts hat die Mutter die Ortungs-App ausschließlich aus persönlichen und familiären Motiven installiert. Es sei zwar richtig, dass eine damit durchgeführte Ortung auch ihren früheren Ex erfasse, wenn sich das Kind gerade bei ihm aufhalte. Das sei jedoch unschädlich. Denn nach Auffassung des Europäischen Gerichtshofs sei die Ausnahme auch dann anwendbar, wenn eine Verarbeitung „nebenbei“ auch das Privatleben anderer Personen betreffe. Mehr finde hier nicht statt.
Ausschlaggebend sei nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, dass die Datenverarbeitung als solche ausschließlich in der persönlichen oder familiären Sphäre vorgenommen wird. Dass sie sich auch auf andere Personen auswirken könne, störe nicht. Entscheidend ist nach Auffassung des Gerichts, dass der „Datenumgang im privaten Aktionskreis stattfindet“. Völlig anders läge der Fall, wenn die Frau die Daten beispielsweise an jemand anderen weitergeben würde.
Der Begriff „Haushalts-Ausnahme“ täuscht
Ausdrücklich weist das Gericht darauf hin, dass man sich von dem Begriff „Haushalts-Ausnahme“ nicht täuschen lassen dürfe. Der Mann hatte nämlich argumentiert, die „Haushalts-Ausnahme“ sei schon deshalb nicht anwendbar, weil er mit seiner Frau ja keinen gemeinsamen Haushalt mehr führe.
Von solchen Überlegungen will das Gericht jedoch nichts wissen. Bei dem Begriff handle es sich lediglich um einen „umgangssprachlichen Terminus“, aus dem keine rechtlich relevanten Rückschlüsse gezogen werden können.
Die App hat keine Abhörfunktion mehr
In seiner Beschwerde bei der Datenschutzaufsicht hatte der Vater auch behauptet, dass es in der App eine Funktion „Umgebungsgeräusche“ gebe. Mit ihrer Hilfe hätte die Mutter mithören können, was sich während eines Aufenthalts der Tochter beim Vater abspielt. Ob die App eine solche Möglichkeit bietet, wurde in der Öffentlichkeit bereits ab etwa 2018 immer wieder diskutiert. Aus der Sicht des Gerichts bestand kein Anlass, sich damit vertieft auseinanderzusetzen.
Die Mutter konnte nämlich ein Schreiben der deutschen Bundesnetzagentur in Bonn vom 19.10.2021 vorlegen. Aus dieser amtlichen Auskunft einer deutschen Behörde ergibt sich, dass diese Funktion in der App zwar ursprünglich zur Verfügung stand. Sie wurde jedoch auf Veranlassung der Bundesnetzagentur ab März 2019 durch eine entsprechende Voreinstellung deaktiviert, weil sie gegen die Vorgaben des Telekommunikationsgesetzes verstößt. Nutzer der App haben keine Möglichkeit, diese Funktion individuell wieder zu aktivieren.
Möglicherweise findet der Streit eine Fortsetzung
Das österreichische Bundesverwaltungsgericht ist anders als das deutsche Gericht, dass diese Bezeichnung trägt, keineswegs die letzte reguläre Instanz. Vielmehr hat das Bundesverwaltungsgericht ausdrücklich die Revision zum österreichischen Verwaltungsgerichtshof zugelassen. Ob eine solche Revision eingelegt wurde, war nicht sicher zu ermitteln.
Hier finden Sie die Entscheidung
Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts trägt das Datum 22.10.2024 (nicht: 2025) und hat das Aktenzeichen W252 2286224-1/6E. Sie ist hier abrufbar: BVWGT_20241022_W252_2286224_1_00.pdf